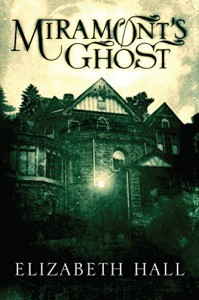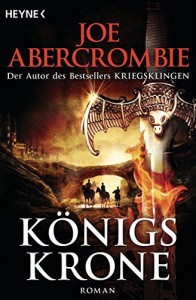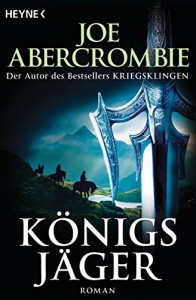Karma is a bitch

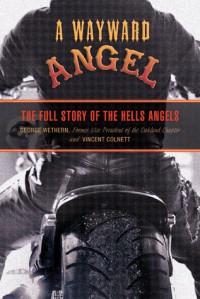
Seit ich vor Jahren das erste Mal im Zuge meiner Recherchen zu den Hell’s Angels von George Wethern las, fasziniert mich seine Geschichte. Wethern war das erste ehemalige Mitglied der Hell’s Angels, das gegen den Motorradclub als Kronzeuge aussagte. Er wurde zum Verräter – und ich wollte wissen, wieso. Im Rahmen dieser eingeschworenen Männertruppe erschien es mir völlig abwegig, dass er sich dazu überreden ließ, der Polizei gegenüber Interna preiszugeben. Ihm dürfte klargewesen sein, dass er damit sowohl sein als auch das Leben seiner Familie verwirkte. Außerdem war Wethern kein durchschnittliches Mitglied. Ab 1960 war er Vizepräsident des Oakland Charters. Der einzige, der in der Hierarchie über ihm stand, war Ralph »Sonny« Barger persönlich, mit dem ihn eine enge Freundschaft verband. Warum also entschied sich jemand, der innerhalb der Strukturen des Clubs erfolgreich und mit dem Big Boss unbestreitbar dicke war, zu singen?
Ich wusste, dass George Wethern mit der Unterstützung des Journalisten und Schriftstellers Vincent Colnett 1978 eine Autobiografie veröffentlicht hatte. „A Wayward Angel: The Full Story of the Hell‘s Angels“ stand lange auf meiner Wunschliste, erst in der deutschen Variante, später dann im englischen Original. Es dauerte, bis ich eine günstige gebrauchte Ausgabe fand, denn ich war nicht bereit, eine höhere Summe für das Buch zu investieren, weil ich bereits all meine romantischen Illusionen bezüglich des MCs abgelegt hatte. Vielleicht hätte ich es nie gekauft – hätte ich nicht im Februar 2019 „Hell’s Angel: Mein Leben“ gelesen, die kaum ernstzunehmende Autobiografie von Ralph »Sonny« Barger. Barger schreibt darin sehr abfällig über Wethern und geht verdächtig wenig auf seine Freundschaft mit seinem ehemaligen Vize ein. Auf mich wirkte es, als vermeide er dieses unliebsame Kapitel absichtlich, was meiner Neugier neue Nahrung lieferte. Ich wollte es jetzt endlich wissen. Was war damals vorgefallen? Wieso wandte sich George Wethern gegen seinen Club? Ich kaufte „A Wayward Angel“ und beschloss, Wethern selbst zu Wort kommen zu lassen.
George Wethern wurde 1939 in Oakland, Kalifornien geboren. Seine Eltern waren beide berufstätig und versuchten, ihm und seinen Geschwistern sowohl eine gute Ausbildung als auch so viele Annehmlichkeiten wie möglich zukommen zu lassen. Er besuchte katholische Schulen, musste niemals hungern und war immer gut gekleidet. Trotzdem war der junge George rastlos und lehnte sich gegen jede Autorität auf, die ihm begegnete. Er genoss seinen Ruf als harter Typ, trieb sich in zweifelhafter Gesellschaft herum und war weit mehr an Mädchen interessiert als an Hausaufgaben. Um ihn von einer jungen Dame namens Judy fernzuhalten, verfrachtete ihn seine Mutter zur Air Force, als er 16 Jahre alt war. Es folgte eine kurze, verfehlte Karriere beim Militär, aus dem er 1958 mit einigen Disziplinarstrafen auf dem Kerbholz unehrenhaft entlassen wurde.
Zurück in Oakland traf er die 15-jährige Helen. Vermutlich hätte er damals, mit gerade einmal 19 Jahren, niemals angenommen, dass ihm soeben die große Liebe seines Lebens und spätere Ehefrau begegnet war, mit der er zwei Kinder bekommen sollte.
Im Grunde kehrte Wethern zum selben Alltag zurück, den er für die Air Force hinter sich gelassen hatte. Doch weil er nicht mehr zur Schule ging und zuerst arbeitslos war, langweilte er sich. Er hatte zwei Freunde, Jerry und Junior, die mit einem lokalen Motorradclub herumhingen: den Hell’s Angels. Wethern war fasziniert von der Kameraderie und der taffen Einstellung der Mitglieder. Er besorgte sich eine gebrauchte Harley und stellte sich dem Präsidenten vor, Ralph Hubert Barger, von seinen Freunden »Sonny« genannt. Drei Wochen später wurde Wethern offiziell in den Club aufgenommen. Kurz darauf erfuhr Helen, dass sie schwanger war. George tat das einzige, das Ende der 50er Jahre in so einer Situation als richtig erachtet wurde: er heiratete sie und zog mit ihr in ihre erste gemeinsame, winzige Wohnung.
Es war für George Wethern von Anfang an schwer, sein Familienleben und seine Verpflichtungen den Hell’s Angels gegenüber unter einen Hut zu bekommen. Er wollte alles auf einmal; er wollte sowohl ein guter Familienvater sein, der für seine Frau und seine Tochter sorgte, ebenso wollte er aber auch aktiv an der Outlaw-Kultur des Clubs teilnehmen, Partys feiern, lange Motorradfahrten miterleben und sich von niemandem etwas vorschreiben lassen. 1960 wurde er Vizepräsident und seine Tochter Donna wurde geboren. Einige Monate später ordneten sich seine Prioritäten neu, als seine Mutter an Krebs starb. Plötzlich waren ihm die Hell’s Angels nicht mehr so wichtig, lieber wollte er Zeit mit seiner jungen Familie verbringen. Er wollte sein mageres Gehalt bei einer Baufirma nicht länger für die vielen Unkosten ausgeben, die das Clubleben mit sich brachte. Obwohl einige der Angels, besonders Barger, versuchten, ihn davon abzuhalten, hängte er seine Kutte vorübergehend an den Nagel.
Fünf Jahre lang trug George Wethern kein Patch. Das hinderte ihn jedoch nicht daran, weiterhin an den Aktivitäten des MCs teilzunehmen und seine Freundschaften zu den Mitgliedern zu pflegen, als wäre nie etwas geschehen. Obwohl zwischenzeitlich sein Sohn Bobby geboren wurde, war er weit davon entfernt, geläutert zu sein. Sein Wiedereintritt 1966 war rückblickend unvermeidlich. Er hatte nicht mit den Hell’s Angels abgeschlossen. Was ihn letztendlich zurück in die Arme des Clubs trieb, waren allerdings nicht seine engen Beziehungen zu Barger und Konsorten, sondern seine Drogenkarriere.
Wethern hatte früh begonnen, Amphetamine zu nehmen, die es damals noch auf Rezept gab. Anfangs sollte ihm die Pillen helfen, seinen Alltag zu meistern, doch schon bald genoss er den Zustand, in den sie ihn versetzten. Er wechselte von Benzedrin zu Speed und Crank und experimentierte mit LSD. Seine ersten Schritte als Dealer machte er mit Marihuana, das er von Sonny Barger kaufte. Einen Teil behielt er für sich, den Rest verkaufte er. Wirklich ins Rollen kam sein Drogengeschäft, als er sich mit dem Angel Terry The Tramp zusammentat. Gemeinsam zogen sie ein Vertriebssystem (hauptsächlich für LSD) auf, das bereits wenige Monate später ernstzunehmende Gewinne abwarf.
Es wäre verblendet, anzunehmen, die Hell’s Angels hätten nicht gewusst, welche Möglichkeiten sich ihnen dank Wethern boten. Hunter S. Thompson irrte sich, als er behauptete, der Club sei zu chaotisch und undiszipliniert, um im Drogengeschäft Fuß zu fassen. Sobald der MC begriff, dass Wethern nicht nur mit Centbeträgen herumeierte, drängten ihn die Mitglieder, wiedereinzutreten. Wethern selbst betrachtete den Club als Garant für sichere und lukrative Geschäfte. Im Frühjahr 1966 wurde er einstimmig wiederaufgenommen, ohne das langwierige Verfahren, das normalerweise dafür nötig ist.
In den folgenden Jahren mauserte sich George Wethern innerhalb kürzester Zeit zu einem der Dirigenten eines der größten Drogensysteme im Westen der USA. Obwohl er weiterhin selbst in rauen Mengen konsumierte, badete er im Geld und verdiente zwischen $100.000 und $200.000 jährlich. Sein hoher IQ, der schon in der High-School festgestellt wurde, befähigte ihn, sogar im Vollrausch stets den Überblick zu behalten. Er verschaffte den Hell’s Angels eine solide Reputation als verlässliche Drogendealer, die immer zu akzeptablen Preisen lieferten, solange niemand versuchte, sie über den Tisch zu ziehen. Dennoch liefen nicht alle Fäden bei ihm zusammen, weil sich das Geschäft rasch ausweitete und auch Drogen abdeckte, von denen Wethern eher Abstand nahm, zum Beispiel Heroin. Die verschwiegenen Strukturen des MCs eigneten sich hervorragend, um ein Unternehmen im großen Stil zu organisieren, gegen das Ordnungsinstanzen wie die Polizei oder die Staatsanwaltschaft keine Handhabe hatten. Jedes Mitglied, das in das Geschäft einsteigen wollte, konnte es. Es kristallisierte sich eine Hierarchie heraus und wer Verbindungen hatte, stieg schnell auf. Die Hell’s Angels entwickelten sich zu einem Drogenkartell, das zusätzlich mit Waffen und Explosivstoffen handelte. George Wethern stand in der ersten Reihe.
Ende der 60er Jahre war George Wethern demzufolge stärker denn je in das Clubleben eingebunden. Er war ein Schwergewicht in der Hackordnung des MCs. Dies änderte sich jedoch abrupt, als er während einer drogeninduzierten Psychose gegen den Kodex der Hell’s Angels verstieß. Im Januar 1969 schoss Wethern im PCP-Rausch (Angel Dust) auf seinen Freund und Geschäftspartner Zorro. Die Ärzte stellten siebzehn Ein- und Austrittswunden fest. Obwohl Zorro seine Verletzungen überlebte, sie ihre Freundschaft später kitten konnten und er George durch seine Weigerung, Anzeige zu erstatten, vor einer langen Haftstrafe bewahrte, war der Schaden angerichtet. Wethern hatte ein Gesetz des MCs gebrochen: er hatte einen Kameraden lebensbedrohlich verletzt. Die Hell’s Angels betrachteten ihn als Risiko. Einige Mitglieder hatten Angst vor ihm, andere forderten seinen Tod für das, was er Zorro angetan hatte. Sie mieden ihn und behandelten ihn wie eine tickende Zeitbombe. Von Sonny Barger und anderen hochrangigen Angels erhielt er zwar Rückendeckung, aber die Anerkennung und der Respekt, die er zuvor genossen hatte, hatten sich in Misstrauen und Feindseligkeit verwandelt. Wethern litt sehr unter der Verschiebung seines Status. Er fühlte sich machtlos. Es schien, als könne er seinen Ruf unter seinen Brüdern nicht wiederherstellen, egal, was er tat. Er beschloss, es nicht länger zu versuchen. Im Sommer 1969 gab er seinen Austritt bekannt.
Theoretisch konnte damals jedes Mitglied die Hell’s Angels ohne großes Aufsehen verlassen. Heute sieht das vermutlich anders aus, doch Ende der 60er reichten private Gründe aus, um die Mitgliedschaft zu beenden. Praktisch war es allerdings etwas komplizierter. Der Ruhestand war für einen ehemaligen Angel nur dann möglich, wenn es ihm gelang, alle Verbindungen zum Club restlos aufzulösen. Eine Herausforderung, denn für die meisten war der Club ihr Lebensinhalt und das Zentrum ihrer geschäftlichen und privaten Beziehungen. Ein Austritt bedeutete einen radikalen Neuanfang, der dadurch erschwert wurde, dass ein Mitglied im Ruhestand dem MC noch immer verpflichtet war. Aktive Mitglieder konnten von einem Ruheständler alles verlangen, von einem Schlafplatz bis zu einer Waffenlieferung. Der Ruheständler konnte nicht ablehnen; er konnte sich nicht mit einem aktiven Mitglied anlegen, weil das Machtverhältnis immer zugunsten des Aktiven ausfiel. Der einzige Weg, all das zu vermeiden, war, weit weg zu ziehen. Wer diese Option wählte, verzichtete jedoch auf die vielen Vorteile, die der Ruhestand mit sich bringen konnte. Obwohl ein ehemaliges Mitglied keinerlei Ansprüche mehr stellen durfte, kam es vor, dass aktive Mitglieder ihren Einfluss nutzten, um sicherzustellen, dass der Ruheständler Hilfe bekam, wenn er sie benötigte. Diese konnte beispielsweise finanzieller oder rechtlicher Natur sein. George Wethern entschied sich gegen einen Umzug. Er brachte es nicht über sich, all seine Freundschaften und vor allem seine enge Beziehung zu Sonny Barger aufzugeben. Rückblickend ein fataler Fehler.
1968 hatte George Wethern ein Grundstück nördlich von San Francisco gekauft, auf dem er für seine Familie eine Ranch bauen wollte. Als er die Hell’s Angels verließ, waren die Bauarbeiten bereits in vollem Gange. Sonny Barger wusste von dem Grundstück, weil er zur Hälfte Teilhaber war. Im Frühjahr 1970 rief er Wethern an und bat ihn, auf dem Gelände der Ranch die Leiche einer jungen Frau verschwinden lassen zu dürfen, die auf einer der Partys der Hell’s Angels Selbstmord begangenen hatte. Wethern sagte zu. Er schuldete Sonny viel und sah es als Gelegenheit, sich für Jahre der Loyalität zu revanchieren. Dennoch beunruhigte ihn die Leiche, die auf seinem Grund und Boden vergraben lag. Vielleicht ahnte er, dass er einen gefährlichen Präzedenzfall geschaffen hatte. Die Verpflichtungen des Ruhestands zwangen ihn, sein Grundstück ein Jahr später, im Frühling 1971, erneut zur Verfügung zu stellen. Dieses Mal waren es die Leichen zweier Prospects (Anwerber auf die Mitgliedschaft), die verschwinden mussten. Im Gegensatz zu der jungen Frau, die sich laut Sonny selbst getötet hatte, waren diese beiden die Opfer einer völlig aus dem Ruder gelaufenen Party des Richmond Charters der Hell’s Angels. Sie wurden ermordet. Trotz des furchtbaren Geheimnisses, das er nun bewahrte, bemühte sich George Wethern nach Kräften, das Leben seiner Familie weiterzuführen wie bisher und hoffte, dass die Toten einfach irgendwann vergessen sein würden. Seine Hoffnung erfüllte sich nicht.
Am Montag, dem 30. Oktober 1972, vollstreckten Polizeibeamte einen Durchsuchungsbeschluss für George Wetherns Ranch. Ironischerweise wäre es dazu eventuell nicht gekommen, hätte das Charter der Hell’s Angels in Oakland nicht versucht, »Whispering Bill« Pifer zu töten, der in Richmond bei der Ermordung der Prospects anwesend war. Sie glaubten, er sei nicht vertrauenswürdig. Nach einer missglückten Falle, die für Pifer eigentlich tödlich enden sollte, fürchtete dieser, dass sie es wieder versuchen würden und auch seine Familie verletzen könnten. 1972 ging er zur Polizei, weil er sich lieber in die Hände der Ordnungshüter begab und ihren Schutz erbat, als auf die Gnade seiner Brüder zu bauen. Offenbar nahmen ihn die ersten beiden Beamten, denen er von den getöteten Prospects berichtete, nicht ernst. Wochenlang geschah nichts. Dann traf er jedoch zufällig Sergeant Frank Tiscareno, Bruder eines Freundes und Polizist aus Pittsburgh. Zuerst erzählte er Tiscareno nichts. Doch eine Woche später hatte er scheinbar beschlossen, dass dieser der richtige Mann war und lud ihn zu sich ein. Er erzählte ihm alles. Anders als seine Kollegen nahm ihn Tiscareno sehr wohl ernst und leitete sofort eine Untersuchung basierend auf Pifers Behauptungen ein. Wenig später fuhr Pifer mit der Polizei zu George Wetherns Grundstück und identifizierte die Ranch als den Ort, an dem die Leichen der Prospects begraben waren.
Um 6 Uhr morgens bezogen etwa 36 Polizeibeamte ihre Posten vor der Ranch. Beim ersten Anzeichen von Bewegung im Haus forderten sie die Familie mit einem Megafon auf, herauszukommen. George Wethern leistete keinen Widerstand. Da während seiner Befragung deutlich wurde, dass die Polizisten ohnehin von den Leichen auf seinem Grundstück wussten, kooperierte er bereitwillig und zeigte ihnen ihre Gräber. Er wollte unbedingt vermeiden, dass die Autoritäten ihm die Morde anlasteten. Die detaillierten Fragen der Beamten ließen für ihn nur einen Schluss zu: er war verraten worden, von seinen Brüdern, seinem Club, dem er Jahre seines Lebens, sein Blut und all seine Leidenschaft gewidmet hatte.
Wethern wusste, dass seine Zusammenarbeit mit der Polizei Konsequenzen haben würde. Er hatte den Kodex gebrochen. Erneut. Die Hell’s Angels würden versuchen, ihn zum Schweigen zu bringen, entweder, indem sie seine Familie bedrohten oder indem sie ihn selbst umbrachten. Gefängnismauern waren kein Hindernis. Helen weinte bitterlich, als er ihr erzählte, was er getan hatte, denn auch sie wusste, dass er ein toter Mann war. Nach einem Tag in Haft traf das Ehepaar Wethern den Pflichtverteidiger Richard Petersen. Er überzeugte sie davon, dass ihre einzige Option ein Immunitätsdeal war, der ihnen im Austausch für Informationen Schutz vor dem MC zusicherte. Sie willigten ein. Einige Tage wurden die Details verhandelt, doch am Wochenende stand der Deal. George und Helen Wethern bekannten sich in minderen Delikten schuldig, die auf der Ranch konfiszierte Waffen und Drogen betrafen, erhielten jedoch Immunität für alle weiteren Verbrechen. Die Regierung erklärte sich bereit, die gesamte Familie Wethern an einen Ort ihrer Wahl auf dem Bundesgebiet der USA umzusiedeln, inklusive neuer Namen, neuer Papiere, Unterkunftsgarantie, Unterhaltszahlungen und allen notwendigen Veränderungen ihrer äußerlichen Erscheinungen. Im Gegenzug würden die Wetherns den Autoritäten ihre Erinnerungen an 14 Jahre im Dunstkreis der Hell’s Angels zur Verfügung stellen.
Sie beantworteten hunderte Fragen. George Wethern nahm seine Seite des Deals sehr ernst. Tag ein, Tag aus zermarterte er sich das Hirn, um den Beamten verschiedenster Instanzen zufriedenstellende Antworten geben zu können. Trotz dessen fiel es ihm nicht leicht, all das zu verraten, wofür er mehr als ein Jahrzehnt eingestanden hatte. Er bereute zutiefst, alte Freunde und Brüder ans Messer liefern zu müssen und bedauerte, zu welchem Leben er seine Familie verdammte. Von zermürbender Schuld und Verzweiflung getrieben versuchte er eines Tages sogar, sich selbst und Helen zu töten. Glücklicherweise gelang ihm das nicht und kurz darauf erwachte sein Überlebenswille erneut. Nach dem Zwischenfall, der sie beide beinahe in ein frühes Grab gebracht hätte, wurden George und Helen in getrennten Zellen untergebracht. Als Ersatz für persönlichen Kontakt begannen sie, sich täglich bis zu 10 Briefe zu schreiben, die von allen möglichen Offiziellen überbracht wurden. Darin sprachen sie sich gegenseitig Mut zu und beteuerten ihre Liebe für einander und ihre Familie. So überstanden sie die Zeit in Haft, bis sie Anfang Januar 1973 von Bundesbeamten abgeholt und in ihr neues Leben gefahren wurden.
George Wethern, seine Frau Helen und ihre beiden Kinder Donna und Bobby befinden sich seit 1973 im Zeugenschutz. Ihre wahren Identitäten sind ein gut gehütetes Geheimnis, das ausschließlich denjenigen bekannt ist, die (vielleicht bis heute) für ihre Sicherheit sorgen. Inwieweit Vincent Colnett über ihren Aufenthaltsort Bescheid wusste, als er die Wetherns Ende der 70er dabei unterstützte, Georges Autobiografie „A Wayward Angel“ zu verfassen, ist unklar. Möglicherweise haben sie sich nie getroffen. Das Buch sollte der entwurzelten Familie helfen, in ihrem neuen Leben Fuß zu fassen. Neben der dringend benötigten Finanzspritze hofften sie darauf, mit vielen Vorurteilen über die Hell’s Angels aufräumen und ein abschreckendes Beispiel der zerstörerischen Gefahren des Drogenkonsums sein zu können. Seit das Buch 1978 erschien, sind sie meines Wissens nach von der öffentlichen Bildfläche verschwunden. Ich werte das als gutes Zeichen, das darauf hinweist, dass sie nie von den Hell’s Angels gefunden wurden. George wäre heute 81 Jahre alt. Er könnte noch leben.
Uff. Bestimmt habt ihr es schon gemerkt. Es ist mal wieder eine dieser Rezensionen. Non-Fiction zu besprechen, ist für mich immer eine Herausforderung, weil ich mir während des Schreibens permanent die Frage stellen muss, wie viel Kontextwissen ich anbieten kann und muss. Es ist ein Balanceakt zwischen Verständnislücken und Spoilern. Ich habe mich entschieden, in diesem Text zu „A Wayward Angel“ vergleichsweise ausführlich auf das Leben von George Wethern einzugehen, weil ich sichergehen möchte, dass ihr begreift, was für ein Mann er war, als er Mitglied der Hell’s Angels war, sowohl aktiv als auch im Ruhestand. Ich will, dass ihr versteht, dass seine Geschichte wesentlich komplizierter ist, als sie auf den ersten Blick wirkt, damit ihr meine Beurteilung dieses Buches besser einordnen könnt. Also verzeiht mir die lange Zusammenfassung seiner Autobiografie, wie immer versichere ich euch, ich verfolge damit einen bestimmten Zweck.
Ich fand „A Wayward Angel” von George Wethern um Längen besser und hilfreicher als „Hell’s Angel: Mein Leben“ von Ralph »Sonny« Barger. Es ist offener, intimer und glaubwürdiger als die chaotische, unpersönliche Anekdotensammlung, die Barger präsentiert. Natürlich liegt das an ihren unterschiedlichen Ausgangssituationen: als Barger sein Manifest verfasste, war er ein aktives Mitglied der Hell’s Angels; George Wethern hingegen war bereits sechs Jahre zuvor offiziell zum Verräter geworden und hatte nichts mehr zu verlieren. Es gab für ihn keinen Grund zur Zurückhaltung, er konnte Interna preisgeben, ohne die Vergeltung des Clubs fürchten zu müssen. Das einzige Risiko, das er einging, war, sich erneut ins Gedächtnis zu bringen und dadurch sein Leben im Zeugenschutz zu gefährden. Da ich jedoch nicht weiß, wie seine Zusammenarbeit mit Vincent Colnett aussah, kann ich nicht einschätzen, wie hoch dieses Risiko tatsächlich war. Ich lernte George Wethern als Mann kennen, der zur Paranoia tendiert, daher gehe ich davon aus, dass er mehrere Sicherheitsnetze spannte, um dieses Buch gefahrlos veröffentlichen zu können.
George Wethern ist kein geborener Schriftsteller. Seine Autobiografie ist kein brillantes Meisterwerk schriftstellerischer Finesse. Teilweise verwirrte mich die Lektüre, weil das Buch über eine sehr grobe Chronologie verfügt und nicht immer eindeutig ist, in welchem zeitlichen Rahmen Wetherns Ausführungen verankert sind. Das fiel mir besonders bei der Rekapitulation für diese Rezension auf, denn ich hatte oft Schwierigkeiten, Ereignisse mit konkreten Jahreszahlen zu verbinden, abgesehen von den wichtigsten Eckdaten. Erschwert wurde es dadurch, dass „A Wayward Angel“ gar nicht den Anspruch verfolgt, eine schnurgerade, chronologische Auflistung der Lebensstationen des ehemaligen Vizepräsidenten anzubieten. Wethern weicht oft vom roten Faden seiner Biografie ab, um Informationen zu den internen Entwicklungen, Strukturen, Abläufen und Regeln der Hell’s Angels zu integrieren, Anekdoten zum Besten zu geben und seine persönliche Einschätzung verschiedener Mitglieder zu vermitteln. Es war fordernd, daraus den Kern seines Werdegangs herauszufiltern. Außerdem gefiel es mir nicht, dass die Abgrenzung zwischen Erinnerungen und recherchierten Fakten sehr schwammig gestaltet ist. Es ist schwer nachzuvollziehen, wann Vincent Colnett eingriff, um Georges Erzählungen mit dokumentierten Quellen zu untermauern. Ich gehe davon aus, dass alle Fußnoten von Colnett stammen, allerdings befinden sich diese ganz am Ende des Buches, was meine Leseerfahrung durchgängig negativ beeinflusste. Ich möchte eben nicht jedes Mal nach hinten blättern müssen, um Belege nachzulesen.
Übelnehmen kann ich George Wethern diese Mängel jedoch nicht. Er ist kein Schriftsteller. Er ist ein ehemaliger Biker, der seine Erfahrungen niederschrieb, um seine Leser_innen vor dem Lebensstil, den er führte, zu warnen und ihre Neugier zu befriedigen. Es wäre nicht fair, ihn nach denselben Maßstäben zu bewerten, die ich normalerweise anlege. Darüber hinaus schätze ich zwei Eigenschaften von „A Wayward Angel“ ungemein, weshalb es mir leichtfällt, nachsichtig zu sein: es ist ehrlich und authentisch. Das ist mir mehr wert als poetische Sprachblumen.
Dank Wethern glaube ich, wirklich begriffen zu haben, was es bedeutete, in den frühen Jahren des Clubs ein Mitglied der Hell’s Angels zu sein. Er zeigte mir, wie aus dem Haufen unrasierter, freiheitsliebender und autoritätsablehnender junger Männer, die gern Motorrad fuhren und vor allem Spaß haben wollten, ein hochorganisiertes, kriminelles Unternehmen wurde. Mein ursprüngliches Bild der Hell’s Angels kam nicht von ungefähr. Anfangs waren sie tatsächlich diese sympathische Gruppe moderner Barbaren, in der ich mich wiedererkannte. Erst später entwickelten sie sich zu einem Kartell, das überhaupt keine Regeln außer seinen eigenen akzeptiert. Ich habe lange über das Warum gegrübelt und kam zu dem Schluss, dass es keine einfache Antwort gibt. Die Veränderung des MCs fand graduell statt und wurde meiner Ansicht nach stark von den Persönlichkeiten geprägt, die damals den Ton angaben. Sie formten den Club nach ihren individuellen Ideen und Bedürfnissen. George Wethern beispielsweise stieg ins Drogengeschäft ein, weil er einerseits durch seinen eigenen Konsum ohnehin in Kontakt mit der Drogenszene stand und andererseits stetig Geld brauchte. Seine Anstellung im Baugewerbe befriedigte ihn nicht, er verdiente mit sehr harter Arbeit einen Bruchteil dessen, was ihm ein profitabler, bequemer Deal einbrachte. Er sah die Strukturen des Drogenhandels und durchschaute, wie man sie professionalisieren konnte. Es war naheliegend, dass er sich dafür das bereits vorhandene Netzwerk des Clubs zu Nutze machte.
So oder so ähnlich lief es vermutlich in den meisten Bereichen ab. Ein Mitglied trug ein kleines, privates Projekt in den Club, das dann schnell im großen Rahmen adaptiert wurde. Möglichkeit und Gelegenheit. Die Tatsache, dass es sich dabei offenbar grundsätzlich um illegale Güter und Dienstleistungen handelte, lässt sich durch einen Blick in die Biografien der Mitglieder erklären. Viele von ihnen waren von der Gesellschaft enttäuscht. Sie nahmen sich als Außenseiter wahr, die sich von der Gesellschaft im Stich gelassen oder gezielt ausgegrenzt fühlten, wodurch sie eben jener Gesellschaft keinen Respekt entgegenbrachten und kein Problem damit hatten, ihre Gesetze zu brechen. Dieses Selbstverständnis als ungeliebte Rebellen war ein verbindendes Element der Hell’s Angels und ihre Motivation, Unternehmungen zu realisieren, vor denen der normale Bürger zurückschreckte. Der Wunsch nach einer Bruderschaft, die Sehnsucht nach einer Familie einte sie.
Vielleicht war das der Grund, warum George Wetherns Mitgliedschaft bei den Hell’s Angels von Beginn an mit Konflikten behaftet war. Er hatte immer eine Familie. Zuerst in Person seiner Eltern und seiner Geschwister, durch die er ein bescheidenes, aber abgesichertes Leben führte. Es überraschte mich, dass er nicht aus zerrütteten Verhältnissen stammte. Sein Vater war Alkoholiker, doch er scheint das gewesen zu sein, was man heute einen funktionalen Alkoholiker nennt – jemand, der regelmäßig trinkt und trotzdem allen Pflichten nachkommt. Wethern beschreibt keine Gewalt in seinem Elternhaus; auf mich wirkte es, als seien seine Eltern streng, auf ihre Art aber durchaus liebevoll gewesen. Er geht nicht darauf ein, wieso in ihm früh das Bedürfnis zur Rebellion erwachte. Wahrscheinlich weiß er selbst nicht, woher diese Tendenz rührte, denn ich bezweifle, dass er sich jemals einer tiefenpsychologischen Analyse unterzog. Er stellt es dar, als sei er einfach das schwarze Schaf der Familie gewesen, das grundlos immer wieder aneckte.
Ich vermute, dass sein Verhalten anfangs das Ergebnis einer Mischung aus seinem hohen IQ und den ganz normalen Widerständen eines Teenagers war. Die Schule unterforderte und langweilte ihn, also stellte er Blödsinn an. Ich denke, das Schlüsselereignis, das ihn letztendlich auf die schiefe Bahn brachte, war die Entscheidung seiner Mutter, ihn zur Air Force zu schicken. Schon als ich davon las, fand ich diesen Schritt extrem und radikal. Es muss ihn verletzt haben, dass sie ihn mehr oder weniger vor die Tür setzte, denn ich glaube, dass er seine Mutter sehr geliebt hat, was er zwar nie ausdrücklich sagt, zwischen den Zeilen aber recht deutlich erkennbar ist. Schließlich war ihr Tod der Grund für seinen ersten Austritt aus den Hell’s Angels. Dass seine Militärkarriere vor diesem Hintergrund scheiterte, wundert mich überhaupt nicht. Zurück in Oakland stand er vor den Scherben seines noch jungen Lebens: kein Schulabschluss, unehrenhaft aus der Air Force entlassen, keine Ausbildung, kein Job, kein Geld. Das einzige, was er hatte, war sein Ruf. Er war ein bisschen verloren, ziellos. Aus dieser Situation heraus hatte er seine ersten Berührungspunkte mit den Hell’s Angels, harte Jungs mit ähnlich schwierigen Biografien wie er, die nirgendwo richtig dazugehörten und wütend auf die Welt waren, die sie nicht haben wollte. Ich kann verstehen, dass George Wethern unter ihnen das Gefühl hatte, willkommen zu sein. Möglicherweise nutzte er seine Mitgliedschaft darüber hinaus als Provokation, denn seine Mutter hielt von den Rüpeln, mit denen er sich rumtrieb, nicht das Geringste. Einmal jagte sie sie sogar mit dem Besen aus ihrem Haus. Taff, die Gute.
Es ist ein weitverbreitetes Klischee, dass alle Probleme erwachsener Menschen auf Traumata aus der Kindheit zurückzuführen sind. In George Wetherns Fall glaube ich, dass dieses Klischee zutrifft. Ich denke, dass der Knacks im Verhältnis zu seiner Mutter der zugrundeliegende Auslöser dafür war, dass er sich den Hell’s Angels anschloss. Hätte sie ihn nicht zur Air Force verfrachtet und stattdessen versucht, mit ihrem rebellischen, intelligenten Teenager selbst fertigzuwerden, hätte er vielleicht keinen gescheiterten Lebenslauf begonnen und wäre nicht in eine Situation geraten, in der er die Hell’s Angels als seine neue Heimat begrüßte. Bitte versteht mich nicht falsch: ich formuliere hier keine Schuldzuweisungen, ich betreibe Ursachenforschung, denn es war garantiert nicht die Liebe zu Motorrädern, die George Wethern überzeugte, ein Hell’s Angel zu werden. Er fuhr gerne, das will ich nicht bestreiten. Aber soweit ich weiß, kaufte er seine erste Harley nicht aus eigenem Antrieb, sondern gezielt mit der Absicht, sich dem Club vorzustellen und auch später entwickelte er nie die Leidenschaft für die Maschinen, die beispielsweise Ralph »Sonny« Barger bis heute auszeichnet. Wethern konnte sein Bike nie selbst reparieren und erledigte seine alltäglichen Termine lieber mit dem Auto. Er fand bei den Hell’s Angels, was er suchte – mit Motorrädern hatte das allerdings erstaunlich wenig zu tun.
Obwohl der emotionale Bruch mit seiner Familie den idealen Nährboden für seine Karriere bei den Hell’s Angels darstellte, taten sich nach seiner Aufnahme in den Club neue Konflikte auf, die er niemals lösen konnte. Der Grund dafür hat einen Namen: Helen. George Wethern lernte seine Ehefrau kurz vor seinem Eintritt kennen und gründete wenig später (unbeabsichtigt) seine eigene Familie mit ihr. Helen war 16 Jahre alt, als sie mit Donna schwanger war. Sie war ein Teenager und vollkommen von ihrem umtriebigen Ehemann abhängig, denn sie hatte keine Ausbildung und keinen Beruf. Wethern wusste, dass es falsch war, seine jugendliche, schwangere Ehefrau allein in ihrer Wohnung sitzen zu lassen, während er mit dem MC um die Häuser zog. Er wusste auch, dass Helen den Club dafür hasste, dass dieser ihr den Vater ihrer Tochter entzog, lange bevor seine kriminellen Geschäfte ein Thema wurden. Helen wurde zwar ebenso in die Reihen des Clubs aufgenommen wie George (soweit das für eine Frau eben möglich ist) und schloss Freundschaften mit anderen Old Ladys (Ehefrauen und feste Freundinnen) und einigen Angels, aber sie hieß die Mitgliedschaft ihres Mannes niemals gut. Nicht einmal, als sie selbst begann, Drogen zu nehmen, um George näher zu sein. Sie hatte immer das Gefühl, dass der MC ihn ausnutzte und verabscheute die horrenden Forderungen, die dieser an seine Zeit, sein Geld und seinen Lebensstil stellte. Sie versuchte stetig, ihn davon zu überzeugen, die Hell’s Angels zu verlassen. Leider hatte sie damit nie Erfolg.
George Wethern befand sich zwischen den Stühlen. Er war der Mittelpunkt des Tauziehens seiner beiden Familien, die um seine Präsenz buhlten: auf der einen Seite standen Helen und seine Kinder, auf der anderen Seite der MC. Er war hin- und hergerissen und konnte sich deshalb niemals endgültig für eine Partei entscheiden, was wiederum dazu führte, dass er sich nie vollständig und mit aller Konsequenz auf das einließ, was er tat. Selbst im Trubel seiner Spitzenzeiten als Drogenhändler verpasste er Clubtreffen und zahlte das dafür fällige Bußgeld, um bei Helen und den Kindern sein zu können. Mir schien es, als schlügen zwei Herzen in seiner Brust, die gegensätzliche Dinge begehrten. Der verantwortungsbewusste Familienvater, der sich nichts sehnlicher wünschte als ein friedliches, bürgerliches Leben, kollidierte mit dem Drogenkönig des berüchtigten Motorradclubs, der sich weigerte, erwachsen zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Er übte sich im Spagat, eine Belastung, die er wahrscheinlich nicht mal ausgehalten hätte, wäre er clean gewesen. Seine Sucht verschärfte seine Lage zusätzlich, weil er die Realität nicht mehr objektiv beurteilen konnte. Dass er in einem Anfall psychotischer Paranoia auf seinen Partner losging, muss man meiner Ansicht nach als Glücksfall werten. So leid es mir für Zorro tut, es hätte auch viel schlimmer kommen können. Es hätte auch seine Kinder treffen können.
Ich bin mir nicht sicher, inwieweit Wethern sich darüber im Klaren war, dass er seine Kinder und Helen Tag für Tag durch seine Nähe zu den Hell’s Angels und seine Drogengeschäfte in Gefahr brachte. Auf mich wirkte es, als wollte er die Risiken einfach nicht sehen, als wollte er sich nicht eingestehen, dass sie jeder Zeit als Druckmittel zur Zielscheibe hätten werden können. Ich glaube, er wollte sich einreden, dass sie sicher waren, was natürlich ein Trugschluss war. So mächtig er sich damals fühlte, er war nicht unantastbar. Ein Streit im MC, ein schiefgelaufener Deal, ein ambitionierter Konkurrent – eine dieser Möglichkeiten hätte ausgereicht, um Helens Leben und die Leben seiner Kinder ernsthaft zu bedrohen. Meiner Meinung nach unterschätzte er vor allem, was seine Brüder zu tun bereit waren, um ihre pervertierte Form von Gerechtigkeit durchzusetzen, obwohl er selbst miterlebte, wie der Club tiefer und tiefer in eine Spirale der Gewalt abrutschte. Er hielt es für undenkbar, dass er ihr Opfer werden könnte. Deshalb denke ich, dass er 1969 gerade noch rechtzeitig ausstieg, wenn auch unfreiwillig. Die Ereignisse, die sich nach seinem Austritt abspielten und ihm drei Leichen auf seinem Grundstück bescherten, beweisen mir, dass George Wethern die allerletzte Ausfahrt nahm, bevor es clubintern richtig haarig wurde. Ich möchte mir nicht ausmalen, was geschehen wäre, wäre er ein aktives Mitglied geblieben.
Außerdem beschlich mich der Eindruck, dass er es genoss, bis zu einem gewissen Grad von den ständigen Verpflichtungen den Hell’s Angels gegenüber befreit zu sein. So wenig sich sein Lebensstil durch seinen Austritt änderte, ich hatte trotzdem das Gefühl, dass er keine Lust mehr hatte, in den Mist hineingezogen zu werden, den die aktiven Mitglieder verzapften. Ich kann das durchaus verstehen. Sie wollten ihn nicht mehr in ihren Reihen, aber um hinter ihnen aufzuräumen, war er gut genug. Freundschaft und Treue hin oder her, niemand möchte plötzlich für drei Leichen verantwortlich sein. Daher kann ich auch nachvollziehen, dass er nicht bereit war, für drei Morde, die er nicht begangen hatte, im Namen eines Clubs, der ihn nicht länger akzeptierte, ins Gefängnis zu wandern. Seine Annahme, ein Bruder hätte ihn verraten, war korrekt und ich gehe davon aus, dass er sich dadurch nicht mehr an das Credo der Verschwiegenheit gebunden sah. Es spielte keine Rolle, dass es jemand war, den er vermutlich nicht mal persönlich kannte. Eine der bedeutendsten, identitätsstiftenden Regeln der Hell’s Angels war gebrochen worden, eines der Gesetze, die das Selbstverständnis des Clubs bestimmen. Es muss sich angefühlt haben, als sei alles, was Wethern länger als ein Jahrzehnt verteidigte, obsolet.
Ich frage mich, ob George Wethern sich rückblickend mehr darüber ärgerte, dass er alles verlor, weil sein ehemaliges Charter »Whispering Bill« Pifer in eine Ecke trieb, in der ihm keine andere Wahl blieb, als sich an die Polizei zu wenden oder ob sich sein Zorn auf »Whispering Bill« Pifer selbst richtete, der das Geheimnis der ermordeten Prospects ausplauderte. Vielleicht verfluchte er das gesamte Richmond Charter, weil dessen Mitglieder es erst versäumten, den Verlauf ihrer Party zu kontrollieren und dann nicht einmal fähig waren, sich selbst um die Leichen zu kümmern. Möglicherweise empfand er aber auch gar keine Wut, sondern nur Erleichterung, vergleichsweise glimpflich davongekommen zu sein. Ich denke jedoch, dass Jahre vergingen, bis er in der Lage war, zu erkennen, dass Pifer wahrscheinlich das Beste war, was seiner Familie passieren konnte. Von allein wäre er dem Einfluss der Hell’s Angels niemals entkommen, davon bin ich fest überzeugt. Das Zeugenschutzprogramm ist sicher kein Zuckerschlecken und es war bestimmt nicht einfach, noch einmal ganz von vorn anzufangen und sich ein Leben aufzubauen, das auf (notwendigen) Lügen basiert, aber ohne diesen radikalen Bruch hätte er es nicht geschafft, sich zu distanzieren. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er irgendwann wieder eingetreten wäre. Darüber hinaus befürchte ich, dass weder Helen noch George in der Nähe des MCs jemals clean geworden wären. Drogen gehörten zu ihrem Alltag so selbstverständlich dazu, dass es ihnen nicht eingefallen wäre, einen Entzug zu machen. Meinem Empfinden nach waren ihre Verbindungen zu den Hell’s Angels ganz entscheidend von Substanzmissbrauch geprägt – das eine ohne das andere war einfach nicht denkbar. Um aufzuhören, mussten sie aus der Peripherie des Clubs ein für alle Mal verschwinden.
Meiner Ansicht nach wurde George Wethern von den Hell’s Angels unfair behandelt. Nach allem, was er für den Club getan, aufgegeben und riskiert hatte, blickte er einer möglichen Hinrichtung entgegen, weil er versuchte, seine Familie vor den Folgen eines Geheimnisbruchs zu schützen, der nicht ihm angelastet werden kann. Mir ist klar, dass es für den berüchtigten Motorradclub diesbezüglich wahrscheinlich keine Grauzonen gibt. Sie hätten ihn, seine Frau und/oder seine Kinder schon aus Prinzip umgebracht. Wer redet, bekommt die Konsequenzen zu spüren, Punkt. Ich finde jedoch, dass sie sich Wetherns Redseligkeit selbst einbrockten. Erst, indem sie ihn wie einen Aussätzigen behandelten, was das Vertrauen des ehemaligen Vize in die hochgerühmte Bruderschaft des Clubs drastisch erschüttert haben dürfte; dann durch die Anhäufung schwerwiegender Verbrechen, die Anfang der 70er Jahre zu einem erhöhten Interesse der Strafverfolgung führte und schlussendlich durch die fatale Fehleinschätzung, wie mit »Whispering Bill« Pifer umgegangen werden sollte. Sie nutzten seine weiterhin bestehende Loyalität aus und brachten ihn in eine Situation, in der er zwischen seiner Familie und dem MC wählen musste. Nach all den Jahren des Tauziehens traf er endlich die richtige Entscheidung, die eigentlich jeder Mensch nachempfinden können sollte. Dafür getötet zu werden, ist himmelschreiend ungerecht.
Bei aller Sympathie, die ich für George Wethern verspüre, weil er mir sehr intime, ehrliche und eindringliche Einblicke in eine Welt gewährte, um die sich viele Mythen ranken, möchte ich dennoch eines festhalten: er ist kein Opfer. Er war es nie. Er war ein Täter. Mitleid wäre fehlgeleitet. Alles, was ihm widerfahren ist, kann und muss darauf zurückgeführt werden, dass er ein Hell’s Angel war. Er wirkte aktiv daran mit, dass sich der Club zu dem kriminellen Kartell entwickelte, das er noch heute ist. 1978, als „A Wayward Angel“ erschien, konnte Wethern nicht absehen, welche Weichen er damals gestellt hatte. Aber er hat sie gestellt, daran gibt es nichts zu rütteln. Er trägt eine Mitschuld daran, dass die Hell’s Angels Jahrzehnte später weltweit für Drogen-, Waffen- und Menschenhandel stehen, für Hinrichtungen auf offener Straße, für Prostitution. Er hatte Einfluss und formte die Identität des MCs ebenso wie Ralph »Sonny« Barger. Es ist zu leicht, während der Lektüre seiner Autobiografie zu vergessen, dass all seine Taten echte Menschen berührten, verletzten und ruinierten. Seine Lebensgeschichte ist nicht abstrakt. Seine Mitgliedschaft bei den Hell’s Angels war kein Spiel. Obwohl er als vergleichsweise „harmloser“ Angel durchging, weil er keine Morde beging, sollte niemand unterschätzen, wie viel Leid er allein durch seine weitreichenden Drogengeschäfte verursachte, für die er niemals offiziell zur Rechenschaft gezogen wurde.
Nun könnte man argumentieren, dass Drogenkonsum in den 60er und 70er Jahren anders betrachtet wurde als heute, besonders in der Hippie-Bewegung beinahe zum guten Ton zählte und noch nicht bekannt war, wie gravierend und gefährlich die Auswirkungen diverser Substanzen sind. Doch George Wethern konnte durch seinen eigenen Konsum und die Beobachtung anderer Mitglieder durchaus abschätzen, was Drogen einem Menschen antun können. Er sah Brüder daran zugrunde gehen. Er hätte seinen Freund und Geschäftspartner Zorro beinahe getötet, weil er unter dem Einfluss von PCP, einem Tierberuhigungsmittel, nicht mehr klar denken konnte. Zu behaupten, er hätte nicht gewusst, welches Gift er unters Volk brachte, wäre gelogen.
Es ist für mich schwer einzuschätzen, wie Wethern seine früheren Verbrechen im Nachhinein beurteilt. Sogar nach den über 250 Seiten seiner Autobiografie kann ich nicht sagen, was er empfindet, wenn er an seine turbulente, kriminelle Zeit bei den Hell’s Angels zurückdenkt. Wehmut? Schuld? Bedauern? Ich weiß es nicht, weil „A Wayward Angel“ akribisch nüchtern gestaltet ist. Der ehemalige Vize schildert all seine Erlebnisse auf eine Weise, die es Leser_innen zwar erlaubt, sich in seine Vergangenheit hineinzuversetzen, aber seine Gefühlswelt zum Zeitpunkt des Entstehens des Buches schirmt er ausnahmslos ab. Vielleicht konnte er seine Geschichte nicht anders erzählen. Vielleicht brauchte er die künstliche Distanz, um überhaupt über das sprechen zu können, was er erlebte. Ich bin hin- und hergerissen, was ich davon halte. Einerseits finde ich, dass seine Beschreibungen der haarsträubenden Fakten seines Lebens gerade durch ihre Nüchternheit effektvoller sind, als sie es mit moralischem Subtext jemals hätten sein können. Es gefällt mir auch, dass Wethern niemals den Eindruck erweckt, sich zu beklagen, zu rechtfertigen, Ausreden zu erfinden oder sich allgemein besser darzustellen, als er war. Das Gefühl, die reine Wahrheit zu erfahren, egal wie unangenehm sie für den Autor gewesen sein mag, begleitete mich die ganze Lektüre über. Und doch… Andererseits fehlte mir Reue. Da Wethern gar keine Ahnung seiner Emotionen vermittelt, klammert er auch aus, ob er seine Taten rückblickend bereut, angefangen mit seinem Eintritt bei den Hell’s Angels, über das, was er Helen und seinen Kindern zumutete, bis hin zu seiner Rolle als Drogenbaron. Ich vermute, dass er es tut, aber ich kann es nicht mit Garantie sagen.
Der rechtschaffene, integre und etwas naive Teil meines Ichs, der immer in allen Menschen das Gute sehen möchte, hätte sich gewünscht, dass Wetherns Läuterung deutlich zu erkennen wäre. Der zynische Teil meines Ichs hingegen fragt sich, was das gebracht hätte. Wäre irgendjemandem damit geholfen gewesen, wäre Wethern in „A Wayward Angel“ zu Kreuze gekrochen? Hätte er dadurch irgendein Unrecht, für das er verantwortlich war, wieder gut gemacht? Nein, natürlich nicht. Allerdings hätte er nicht um Absolution betteln müssen, um zu vermitteln, dass ihm bewusst ist, wie falsch sein früheres Verhalten war. Hätte er selbstkritisch reflektiert, statt nur zu erinnern, wäre dieser Eindruck ganz von selbst entstanden. Leider gelang ihm das nicht, weshalb ich selbst nach der Lektüre nicht sicher bin, wie ausgeprägt sein Unrechtsbewusstsein ist und dieses lediglich zwischen den Zeilen vermuten kann.
Meiner Ansicht nach erntete George Wethern, was er säte. Er ließ sich mit Männern ein, deren Potential zur Gewalt und Kriminalität von Anfang an sehr hoch war und spielte eine entscheidende Rolle dabei, dieses Potential zur Entfaltung zu bringen. Gibt es in seiner Lebensgeschichte überhaupt unschuldige Opfer, sind es seine Kinder, auf die die fragwürdigen Entscheidungen ihrer Eltern (ja, ich sehe auch Helen verantwortlich, denn sie hätte ihren Ehemann stets verlassen können) immensen Einfluss hatten. Trotzdem danke ich ihm für diese Autobiografie, die mich lehrte, dass der Weg, den die Hell’s Angels einschlugen, vorgezeichnet war. Ich verstehe nach der Lektüre wesentlich besser, wie sie sich zu einer hochorganisierten, global agierenden, kriminellen Vereinigung entwickeln konnten. Diese an mir nagende Frage wurde beantwortet. Für mein eigenes Leben nehme ich aus „A Wayward Angel“ glücklicherweise nichts mit. Dafür sind George Wetherns Erlebnisse zu weit von mir entfernt. Aber ich möchte mit einer allgemein gültigen Weisheit schließen, die auf Wethern passt wie die Faust aufs Auge: Karma is a bitch.
 2
2


 1
1